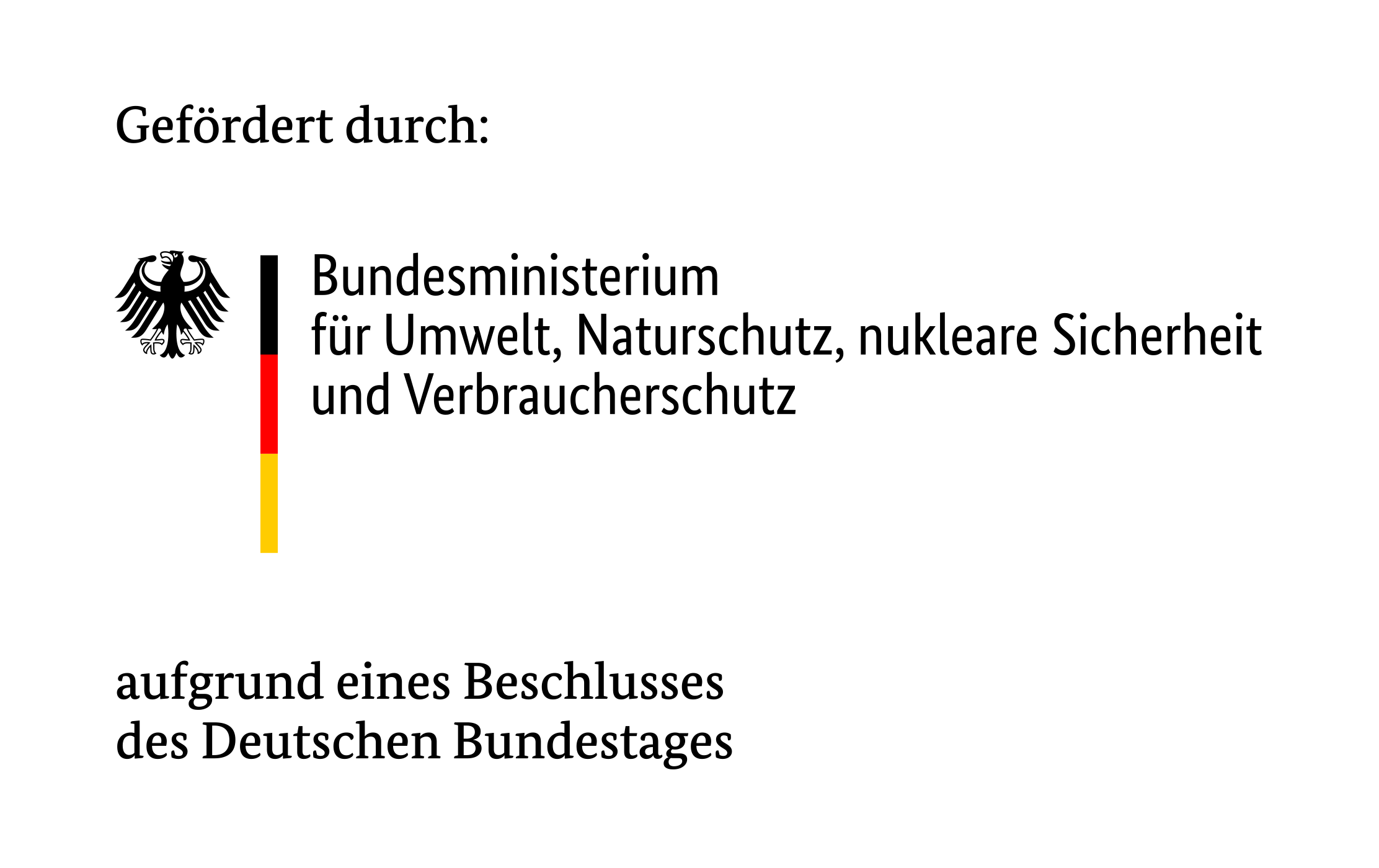Patrick Lohmeier: Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn sie im Geschäft ein T-Shirt für 5 € oder eine Hose für 20 € in der Hand halten? Vielleicht gibt es auch noch Rabatt wenn man ein zweites oder drittes Teil kauft. Also, ich habe immer sehr zwiespältiges Gefühl dabei. Klar, da ist die Freude über das vermeintliche Schnäppchen. Das schlechte Gewissen meldet sich angesichts solch erstaunlich günstiger Preise aber auch ganz schnell zu Wort, oder? Man muss kein Ökonom sein oder alles über Nachhaltigkeit Wissen, um sich auszurechnen dass dieses Hemd oder diese Hose vermutlich sehr billig produziert wurden, um zu einem günstigen Preis an uns verkauft werden zu können.
Ein Baumwollshirt, gefärbt, genäht und verschifft am anderen Ende der Welt ist nur dann für 5 € zu haben, wenn Aspekte wie Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte bei der Produktion und Vertrieb keine Rolle spielen. In unserer neuen Folge von genau genommen sprechen wir darüber, warum die Massenproduktion von billig Mode nicht nur schlecht für Mensch und Umwelt ist, sondern uns geradezu verführt, mehr Geld für Mode auszugeben als wir sollten. Ich habe viele weitere Fragen in der Einkaufstüte. Nämlich: Kann ich eigentlich auch als Laie erkennen welches Kleidungsstück ja fair und ökologisch einwandfrei produziert wurde? Wie versuchen Modelabels und Ketten mit angeblich nachhaltiger Mode ein Geschäft zu machen? Wie viele Kleidungsstücke hat jeder von uns im Kleiderschrank und wie viel davon will oder kann man eigentlich tragen? Wir unterhalten uns heute über faire Mode, Ökowolle, Secondhand-Klamotten und die Suche nach dem besten Style ohne Stress für Mensch, Natur und den eigenen Geldbeutel. Zu Gast ist meine Kollegin und Nachhaltigkeitsexpertin Ruth Preywisch. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören.
Zum Thema Fair Fashion habe ich mir Ruth Preywisch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz eingeladen. Hallo, Ruth!
Ruth Preywisch: Hallo, Patrick!
Lohmeier: Stell doch mal deine Arbeit bei der Verbraucherzentrale kurz vor.
Preywisch: Ich leite ein kleines, aber feines Projekt. Das heißt Das geht! Nachhaltig konsumieren und leben und da geht's eben um das Thema nachhaltigen Konsum, um Textilien um Elektroschrott und digitale Nachhaltigkeit.
Lohmeier: Ein Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigst ist Fair Fashion und mich interessiert natürlich zuallererst einmal, was versteht man eigentlich unter fairer Mode?
Preywisch: Also fair produzierte Mode ist Mode, bei der die Produktionsbedingungen gut sind, sprich: Arbeitnehmerrechte geachtet werden, Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer eingehalten wird und Mindestlöhne gezahlt werden. Das Ganze ist ein bisschen abzugrenzen von sowas wie Biomode, auch wenn es diesen Begriff eigentlich nicht gibt, denn bei fairer Mode ist nicht unbedingt auch Umweltschutz oder Klimaschutz mit einbegriffen, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Produktionsbedingungen einfach fair sind.
Lohmeier: Das klingt ja im eigentlichen Wortsinn "gerecht". Wie würdest du denn Unfair Fashion beschreiben, also konventionelle Mode aus der Massenproduktion?
Preywisch: Das ausdrückliche Gegenteil von Fair Fashion ist erstmal einfach Mode, die unter schlechten Produktionsbedingungen hergestellt wird. Als allererstes fällt einem da wahrscheinlich Fast Fashion ein, wo einfach so viel und auch so schnell produziert wird, dass mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass eben keine guten Produktionsbedingungen herrschen in den Ländern, wo die Kleidung dann tatsächlich produziert wird. Das betrifft allerdings nicht nur den Fast-Fashion-Bereich, denn auch bei Markenmode kann es sein, dass auch unter schlechten Bedingungen produziert wird, weil auch Markenmode oft in den gleichen Fabriken hergestellt wird oder die Baumwolle auf den gleichen Feldern angebaut wird. Man kann nicht unbedingt den Unterschied sofort sehen am Preis oder an der Marke.
Lohmeier: Ich möchte und kann mich auch gar nicht davon freisprechen, dass ich selber schon diesem Trugschluss aufgesessen bin, dass ich, wenn ich für einen Markenartikel Geld ausgebe, mit diesem Kauf auch gleich die unausgesprochene Annahme einhergeht, dass das alles schon einigermaßen fair und nachhaltig produziert ist. Zumindest im direkten Vergleich zu den sogenannten Fast-Fashion-Modelabeln und -Ketten.
Preywisch: Ja, das ist leider ein Trugschluss, weil man es am Preis alleine tatsächlich nicht festmachen kann. Es ist schon so, dass nachhaltiger oder auch fairer produzierte Mode teurer ist, weil einfach entlang der Lieferkette die Arbeiter besser bezahlt werden, das Material noch mal anders hergestellt wird und so weiter und so fort. Aber es lässt sich tatsächlich nicht nur am Preis festmachen. Gerade bei Markenmode ist es einfach so, dass die Unternehmen da Preisaufschläge machen nur für die Marke und das hat eben nichts damit zu tun, unter welchen Bedingungen ein Kleidungsstück hergestellt wurde.
Lohmeier: Da wir gerade schon ein paar negative Aspekte von solch unfairer Massenproduktion besprochen haben: Was sind deren die Konsequenzen?
Preywisch: Die sind ziemlich umfangreich, da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen soll, da das ja ganz viele Bereiche umfasst. Gerade bei nicht fair produzierten Textilien ist es so, dass es einfach sehr häufig zu Ausbeutung kommt das heißt, es werden wirklich sehr niedrige Löhne gezahlt da, wo die Kleidung zusammengenäht wird oder auch, wo die Baumwolle verarbeitet oder gefärbt wird. Es gibt sehr wenig Arbeitsschutz für die Menschen, die die Sachen produzieren, denn anders lassen sich günstige Preise auch gar nicht realisieren. Ein ordentlicher Lohn und ein ordentlicher Gesundheits- und Arbeitsschutz gehen eben zusammen mit höheren Preisen. Dann ist es auch so, dass es in vielen Fällen nach wie vor zu Kinderarbeit kommt, obwohl die mittlerweile verboten ist und viele Unternehmen das auch ächten und sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie keine Kinderarbeit mehr zulassen auf ihrer Lieferkette. Es passiert aber trotzdem, denn es ist sehr schwierig zu kontrollieren, weil die Lieferketten so lang sind.
Aber es gibt auch noch andere Probleme, die daneben die Umwelt betreffen oder auch das Klima. Zum einen ist es so, dass die Umweltbelastung einfach sehr, sehr hoch ist in der Textilindustrie, weil eben viel mit Pestiziden gearbeitet wird beim Anbau, oder mit Giftstoffen beim Färben von Textilien. Oder auch am Ende, wenn wir die Kleidung hier tragen und waschen und Mikroplastik ausgewaschen wird, was dann in die Umwelt gelangt. Neben der Umweltbelastung es ist auch so, dass es einen sehr hohen Wasserverbrauch gibt in der Textilindustrie, speziell bei Baumwolle. Das ist ein Problem, da eben Baumwolle häufig in Ländern angebaut wird, wo es gar nicht so viel Wasser gibt, der Anbau aber eben sehr wasserintensiv ist. Der CO2-Ausstoß der Modeindustrie beträgt außerdem über zwei Milliarden Tonnen CO2 jährlich. Das sind mehr als 4 Prozenzt des Gesamtausstoßes weltweit von CO2 pro Jahr und mehr als alle Flugreisen und Kreuzfahrten zusammen. Dieser entsteht vorrangig dadurch, dass eben Textilien, bis sie sozusagen als fertiges T-Shirt bei uns im Laden liegen, einen sehr langen Weg hinter sich haben, weil sie quer über die ganze Welt verteilt werden. Da wird in Asien gefärbt, in Afrika die Baumwolle angebaut und das muss alles irgendwie hin und her geschickt und transportiert werden.
Lohmeier: Das sind wirklich alles Probleme - Umweltbelastungen Menschenrechtsverletzungen - von denen sich die Modewirtschaft soweit distanzieren möchte wie möglich und sie tut natürlich auch eine Menge dafür. Also ich ich denke da mal an ganz offensichtliche Sachen wie Online-Werbung, aber eben auch Plakatwerbung und Fernsehwerbung, in der auf nachhaltige Produktion und grüne Mode hingewiesen wird und so weiter und so fort. Da kann man ja viel behaupten. Aber einige Marken und Ketten machen das auch ganz konkret fest an bestimmten Maßnahmen und stellen Recyclingtonnen in ihren Shops auf oder bieten eigene Labels an, die proklamieren: "Das ist grün, das ist nachhaltig, das ist fair und das ist gut produzierte Mode, die du mit guten Gewissen tragen kannst." Was ist davon zu halten, Ruth?
Preywisch: Grundsätzlich ist es so, dass der Modeindustrie schon bewusst ist, dass es da viele Probleme gibt und einige Unternehmen auch tatsächlich wissen, dass sie etwas ändern müssen und das auch angehen und tun. Man kann nicht die komplette Modeindustrie verteufeln. Allerdings ist es so, dass gutes Marketing und schöne grüne Kampagnen viel günstiger sind als eine tatsächliche Umstellung der Produktionsweisen und deshalb ist es bei vielen Unternehmen tatsächlich so, dass die wirklichen Anstrengungen, die unternommen werden, um nachhaltiger zu sein oder fairer zu produzieren, eben nicht so groß sind wie in der Werbung gerne behauptet wird. Das fasst man dann zusammen unter dem Stichwort Greenwashing.
Das heißt, dass die Unternehmen da häufig Nachhaltigkeitsbehauptungen aufstellen, die sie nicht erfüllen oder die sie nicht beweisen können. Das ist ein ganz, ganz großes Problem zum einen, weil wir beim Kleidungskauf auch bereit sind, wenn wir glauben, dass die Mode fairer oder nachhaltiger produziert ist, tatsächlich mehr Geld dafür zu zahlen. Oder wir kaufen schöne, fair produzierte, nachhaltige Mode und haben ein gutes Gewissen und kaufen dann vielleicht auch drei Stück statt einem Stück. So oder so, das Unternehmen verdient Geld und ist glücklich und wir hinterfragen auch gar nicht mehr, ob das jetzt tatsächlich fairer oder nachhaltiger ist, was wir da gekauft haben. Das heißt, wir haben dann einfach ein gutes Gewissen. Wenn das aber nicht stimmt, was die Unternehmen behaupten ja dann haben wir da nichts Faires oder Nachhaltiges gekauft und das Unternehmen muss ich auch nicht mehr weiter anstrengen und irgendwelche Dinge entlang der Lieferkette ändern, weil es funktioniert ja alles so wie es ist.
Leider bleibt einem, wenn man faire oder nachhaltigere Mode kaufen will, auch wirklich nichts anderes übrig als genau hin zu gucken, was die Unternehmen da versprechen. Welche Anstrengungen sie wirklich unternehmen muss man tatsächlich teilweise im Kleingedruckten nachlesen, also was eigentlich mit unserer "Fairen Kollektion" oder "Hier ist alles viel grüner als da drüben" gemeint ist und was dahinter steckt.
Lohmeier: Stichwort "Hingucken": Fällt dir vielleicht ein konkretes Negativbeispiel ein für dieses sogenannte Greenwashing als Marketinginstrument? Also als verkaufsförderndes Mittel, wo ein Unternehmen sagt "Hier, guck mal: alles grün, alles nachhaltig, alles cool, alles fair", aber was sich dann herausstellte als Irreführung der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Preywisch: Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Und zwar haben wir hier bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gerade erfolgreich ein Modeunternehmen abgemahnt, das hatte in seinem Online-Shop einfach mit so einem kleinen Schildchen auf den Produkten geworben, wo "nachhaltig" drauf stand. Dahinter steckte, dass dieses Unternehmen an einer Initiative teilnahm, die nennt sich Better Cotton Initiative. Das funktioniert so: Das Unternehmen bezahlt Geld an diese Initiative und die Initiative produziert Baumwolle unter besseren Bedingungen. Das ist auch erstmal alles vollkommen in Ordnung. Allerdings wird diese Baumwolle dann mit ganz konventionell hergestellter Baumwolle vermischt und weiter verarbeitet und man kann überhaupt nicht sagen, ob in dem Produkt, was das Unternehmen dann mit Nachhaltigkeit ausgezeichnet hat, tatsächlich Baumwolle von dieser Better Cotton Initiative drin steckt. Das heißt, das Unternehmen hätte sagen können: "Wir als Unternehmen unterstützen die Better Cotton Initiative", darf aber nicht an einzelnen Produkten speziell mit Nachhaltigkeit werben, wenn eben gar nicht nachweisbar ist, ob in diesem Produkt überhaupt auch nur ein Fitzelchen besser produzierte Baumwolle drin steckt.
Lohmeier: Dann hat sich das Modeunternehmen quasi freigekauft, also ein reines und gutes Gewissen gekauft, indem sie sagen "Wir geben einfach mal ein bisschen Geld an Menschen oder eine Institution, die schon irgendwas Gutes machen, aber das macht sich eben nicht in unseren Produkten, die wir in unserem Handel anbieten, bemerkbar."
Preywisch: Ich nenne es einfach mal Ausgleichszahlung. Oder eine Spende an Organisationen, die jeder kennt. Oder dass man auch für jedes verkaufte Produkt einen Baum pflanzt. Jetzt möchte ich das per se auch gar nicht unbedingt verteufeln, weil es gibt Organisationen, die das sehr ordentlich machen. Die dann wirklich Umweltschutz oder Arbeitsschutzmaßnahmen oder ähnliches mit dem Geld unterstützen. Trotzdem ändert das eben nichts daran, wie die Produkte tatsächlich hergestellt werden. Also es ist schön, wenn ein Textilunternehmen irgendwo Bäume pflanzt, aber das ändert nichts daran, dass beim Färben der Textilien Giftstoffe in Flüsse gelangen oder Arbeiter diese T-Shirts unter unsäglichen Bedingungen produzieren. Und deshalb ist sowas wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also wer wirklich will, dass es in der Produktion fairer zugeht oder die Textilien nachhaltiger werden, der sollte gerade von solchen Ausgleichsprogrammen besser die Finger lassen.
Lohmeier: Wir sprechen gleich noch über unabhängige Institution, die auch sogenannte Siegel verleihen und haben bereits über die Eigeninitiative von Unternehmen geredet. Aber kurz zur Politik. Kann diese etwas dafür tun, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden vor unfair produzierter Mode?
Preywisch: Ja, das könnte sie schon. Hat sie auch schon in Ansätzen. Es gibt ja z.B. in Deutschland das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz, was seit diesem Jahr [2023] greift und das soll die Unternehmen eben dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen entlang der Lieferkette. Ein bisschen problematisch an dem aktuellen Gesetz ist, dass es eben noch nicht so wirklich weit greift. Da wäre zu wünschen, dass die Politik noch mal nacharbeitet. Es ist aber auch geplant, dass das ausgeweitet wird. Dass eben ein Unternehmen, was in Deutschland Kleidung verkauft, tatsächlich die ganze Lieferkette im Blick haben muss und erkennt, wenn Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigung passieren. Da, wo die Baumwolle hergestellt wird, ist das deutsche Unternehmen dann verpflichtet, einzugreifen und für Verbesserung zu sorgen. Das gibt das Gesetz im Moment noch nicht her. Aber der Vorteil von so einem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz ist eben, dass man es darüber schaffen könnte, dass es Standards gibt, die sicher eingehalten werden. Das heißt, dann muss ich als Konsument nicht mehr die einzelnen Siegel kennen und mir sämtliche Bedingungen angucken und dann noch die Siegel am Kleidungsstück und alles im Blick haben, sondern ich wüsste eben: "Wenn hier etwas verkauft wird, sind bestimmte Mindeststandards einfach auf jeden Fall eingehalten" und das würde viel Last von den Verbrauchern nehmen.
Lohmeier: Jetzt schlussfolgere ich daraus: Auf die Unternehmen ist eigentlich nie oder nur in den seltensten Fällen Verlass und ich muss schon sehr genau hingucken. Sollte ich ab sofort nur noch Secondhand-Kleidung kaufen oder gibt es andere, verlässliche Indikatoren für Mode, die wirklich fair oder grün produziert ist?
Preywisch: Also es gibt Unternehmen, die tatsächlich anders agieren und fairer oder nachhaltiger produzieren. Und man kann die auch finden. Zum einen empfehlen wir da immer, auf bestimmte Siegel zu achten, die für nachhaltigere, fairere Produktionsbedingungen stehen. Da muss man auch noch mal ein bisschen aufpassen, weil es auch Unternehmen gibt, die unternehmenseigene Siegel herausgeben, was auch ein schöner Greenwashing-Trick ist. Wenn man aber weiß, welche von diesen Siegeln tatsächlich unabhängig zertifiziert werden und auch ordentlich überprüft werden und für ordentliche Bedingungen stehen, kann man sich daran schon orientieren und kann sich auch darauf verlassen, dass diese Mode tatsächlich unter besseren Bedingungen hergestellt wurde.
Lohmeier: Was sind die wichtigsten Siegel, also die wichtigsten Kennzeichnungen, auf die man beim nachhaltigen Kaufen achten sollte? Gibt's da irgendwelche positive Ausreißer?
Preywisch: Es gibt nicht das eine faire Nachhaltigkeitssiegel, was alle Kriterien abdeckt. Aber es gibt schon welche, die sowohl für Fairness in der Produktion als auch für gute Umweltstandards stehen. Da gibt es z.B. das GOTS Siegel. Das ist so ein grüner Kreis mit einem weißen T-Shirt drin. Das findet man auch tatsächlich relativ häufig, sogar im Discounter Bereich, was sehr positiv ist. Das Siegel attestiert, dass bestimmte, sogenannte Kernarbeitsnormen eingehalten werden, also z.B. ein Mindestlohn gezahlt wird und ähnliches, und auch 70 Prozent der Fasern aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammen müssen. Das kann man empfehlen. Dann gibt es auch Fairtrade Cotton. Fairtrade ist vielen bekannt aus dem Lebensmittelbereich und das gibt es auch als Siegel für Baumwolle. Dann gibt es den Grünen Knopf. Das ist ein staatliches Meta-Siegel. Wenn andere Zertifizierungen gegeben sind, dann darf man auch den Grünen Knopf benutzen. Darin sind sowohl sowohl ökologische Kriterien als auch Unternehmenskriterien umfasst. Das sind jetzt nicht unbedingt die allerhöchsten Standards, aber eine eine gewisse Basis, die dadurch eingehalten wird. Und dann gibt es eben noch auch kleinere Siegel, die durchaus wirklich gut sind. Es gibt z.B. die sogenannte Fair Wear Foundation. Verschiedene Unternehmen aus dem Outdoorbereich haben sich da zusammengetan und haben gesagt, wir wollen fairer produzieren. Da sind allerdings weniger sind weniger Umweltaspekte dabei.
Lohmeier: Ja das klingt doch gut mit den offiziellen Siegeln. Also eine unabhängige Zertifizierung auf dem Pulli, auf der Hose, auf der Unterwäsche und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die Unternehmen können mit dem guten Gewissen leben, dass hier nachhaltig produziert wurde, oder?
Preywisch: Ganz so einfach ist es leider wieder doch nicht. Das mit den Siegeln ist gut und funktioniert auch ganz gut, sofern es eben unabhängig geprüfte Siegel sind. Das Problem ist nur: In vielen Fällen findet man die Siegel einfach, nicht weil viele Unternehmen sich nicht dafür zertifizieren lassen. Zum einen, weil vielleicht ihre Produktionsbedingungen das auch nicht hergeben. Die Zertifizierung für ein Siegel ist aber auch sehr teuer. Das heißt gerade bei kleinen Unternehmen, die vielleicht tatsächlich fair und nachhaltig produzieren - die gibt es nämlich - kann es sein, dass sie es sich gar nicht leisten können, in ein Siegel zu investieren. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Das heißt bei einem kleinen lokalen Unternehmen, das transparent auf seiner Internetseite über die Lieferkette Auskunft gibt oder seine Bemühungen einfach sehr klar darstellt, aber kein Siegel hat, kann es trotzdem sein, dass das ein Unternehmen ist, was wirklich fairer und nachhaltiger produziert.
Lohmeier: Da hilft wahrscheinlich nur genaues Hingucken. Und gerade bei dem Punkt, und das auch so zum Abschluss, möchte ich sagen, dass ich jeden Menschen verstehen kann, der uns jetzt zuhört und sagt "Ich habe gar nicht die Zeit, beim Modekauf jedes einzelne Kleidungsstück, das mich interessiert, nachzuprüfen, ob denn da Siegel X auf dem Label steht." Was empfiehlst du diesen Menschen, die dafür keine Zeit oder auch gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie vielleicht nicht in der Großstadt wohnen und nicht die Auswahl haben zwischen acht bis zehn Modeketten?
Preywisch: Also eine gute Möglichkeit ist auf jeden Fall, Secondhand-Ware zu kaufen. Denn gerade diese ganze Fast-Fashion-Welt lebt ja auch davon, dass wir ständig neue Sachen kaufen und dann immer mehr produziert werden muss und das eben unter schlechten Bedingungen. Das heißt, je länger Kleidungsstücke getragen werden, umso besser ist es eigentlich und deshalb ist Secondhand-Kleidung tatsächlich eine ganz gute Methode, wenn man sagt: "Ich möchte nicht, dass für die Kleidung, die ich mir kaufe, Leute ausgebeutet werden oder die Umwelt verschmutzt wird." Es lohnt sich aber auch, sich tatsächlich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ein bisschen zu gucken, wofür die erwähnten Siegel stehen oder sich auf ein paar Unternehmen zu konzentrieren, die schon ein bisschen transparenter agieren. Also ich kann jedem, der Kleidung kauft, nur empfehlen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und sich ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Anders wird es nicht funktionieren, so leid es mir tut.
Lohmeier: Das heißt: Fast Fashion geht schnell und Fair Fashion braucht einfach ein bisschen Zeit, würdest du sagen.
Preywisch: Ja, aber dann macht es auch Freude. Weil, wenn man ein Kleidungsstück gefunden hat, von dem man wirklich weiß, das es jetzt mal anders produziert wurde und wahrscheinlich dann sogar eine bessere Qualität hat, kann man es länger tragen. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass man daran tatsächlich mehr Freude hat als an einem schnell in irgendeinem Shop für einen Anlass mitgenommenen Kleid für 6 Euro.
Lohmeier: Und damit tut man nicht nur der Umwelt und anderen Menschen etwas Gutes, sondern auch dem eigenen Geldbeutel, oder?
Preywisch: Definitiv. Also Secondhand kaufen ist z.B. günstiger. Aber es sollte auch vielleicht einfach jeder mal selber in seinem Kleiderschrank zuhause gucken und überlegen: "Was brauche ich eigentlich wirklich?" Wir haben unfassbar viele Kleidungsstücke im Schrank also da möchte ich mich selber jetzt auch gar nicht ausnehmen. Durchschnittlich sind das bei jedem Deutschen fast hundert Kleidungsstücke - ohne Socken, Unterwäsche und Accessoires. Die kann man ja gar nicht alle anziehen. Das heißt, man sollte wirklich mal, bevor man etwas Neues kauft, vielleicht einfach in den eigenen Kleiderschrank gucken und mal schauen, ob es da noch alte Sachen, gibt die man schon ewig nicht mehr an hatte. Wenn man dann merkt: Da hängen viele alte Sachen, ich will sie aber wirklich nicht mehr anziehen, kann man auch überlegen, ob man mal mit der Freundin tauscht oder die Kleidung an irgendwen verschenken kann. Ich denke, dass man mit einem bewussteren Umgang mit Mode wirklich Geld sparen kann. Denn das einzelne Stück ist zwar günstig, aber insgesamt geben wir doch relativ viel Geld aus für Mode im Laufe eines Jahres.
Lohmeier: Vielen Dank für das Gespräch, liebe Ruth, und Grüße nach Mainz.
Preywisch: Ja. ich hoffe, alle machen ein bisschen die Augen auf beim textilen Einkauf.
Lohmeier: Auf jeden Fall. Ich danke dir.
Dies war eine neue Folge von genau genommen. Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcastreihe ermöglichen: Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zu nachhaltigem Shoppen mit echtem Mehrwert für den Geldbeutel finden Sie auch unter www.verbraucherzentrale.de. Falls Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie genau genommen doch bitte in einer Podcast App oder Audio App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie mich per E-Mail an podcast@vz-bln.de. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wiederhören.