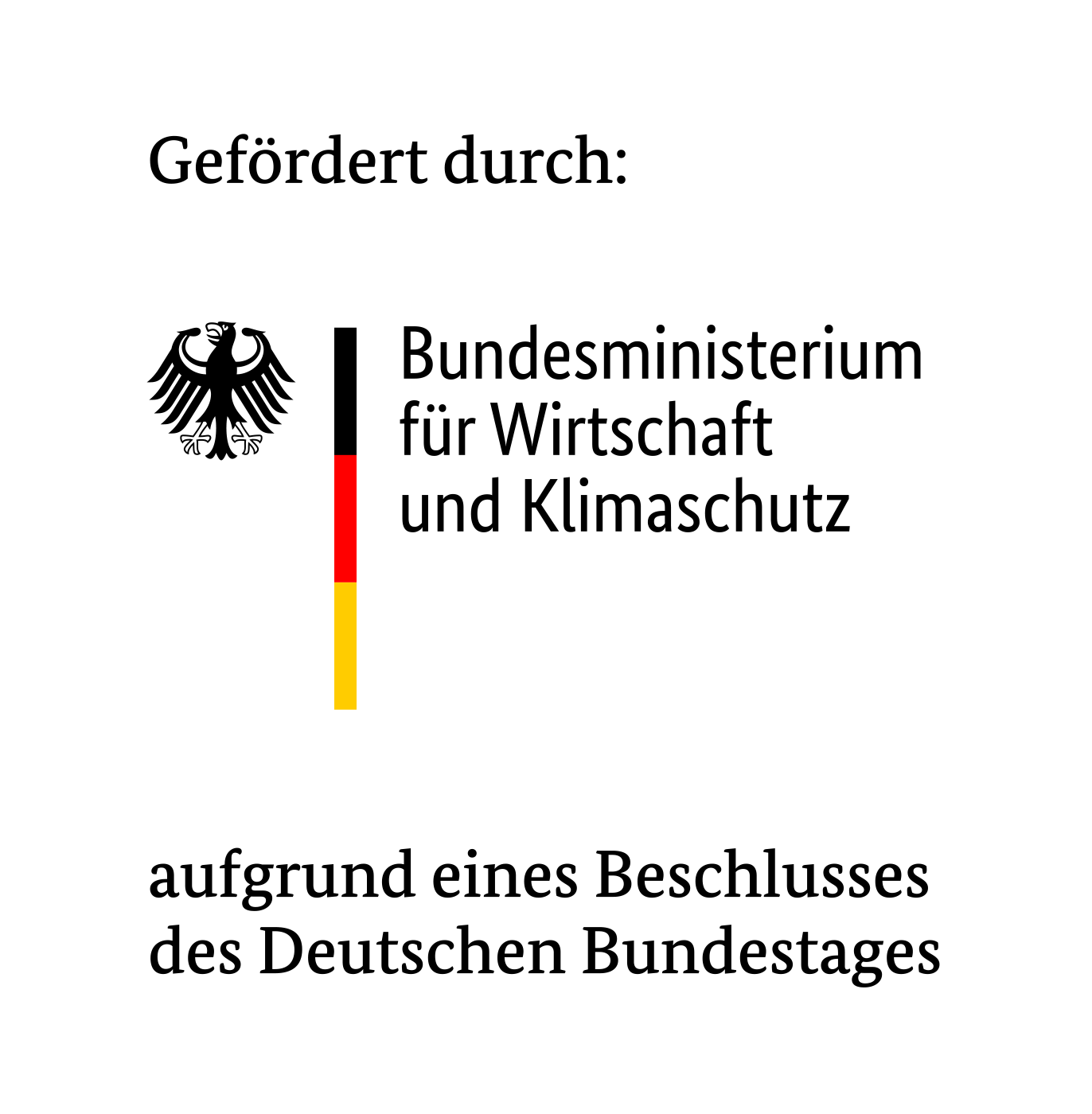Gebäudeeigentümer:innen, die ihre Mietparteien mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage beliefern, gelten bislang als Energieversorgungsunternehmen. „Rechtlich kompliziert und sehr bürokratisch", nennt Inse Ewen, Energieberaterin für die Verbraucherzentrale Bremen, den Mieterstrom. „Und ein Grund, warum immer noch die meisten Mietshäuser keine Photovoltaikanlage haben", ergänzt die Verbraucherschützerin.
Die erst 2024 in Kraft getretene Neuregelung zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung soll die Nutzung von Photovoltaik einfacher und damit attraktiver auch für Mehrfamilienhäuser machen.
Unterschiede zwischen gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung und Mieterstrom
Im Unterschied zum Mieterstrom gibt es keine Vollversorgung. Der Gebäudeeigentümer teilt lediglich den verfügbaren Solarstrom unter den beteiligten Mietparteien auf. Das bedeutet, dass die Mietparteien weiterhin eine eigene Stromversorgung benötigen und ihre bisherigen Stromverträge behalten können. Durch den Solarstromanteil verringert sich lediglich deren Strombezug.
Der jeweilige Solarstromanteil wird für jede beteiligte Mietpartie in einem Gebäudenutzungsstromvertrag vereinbart. Haushalte, die sich nicht beteiligen möchten, sind dazu auch nicht verpflichtet.
Anders als beim Mieterstrom gibt es für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung keine Förderung.
Welche Voraussetzungen müssen Gebäudeeigentümer für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung erfüllen?
Es muss eine Stromerzeugungsanlage an oder auf dem Gebäude existieren. In der Regel handelt es sich dabei um eine Photovoltaikanlage. Auch der Strom aus einem damit verbundenen Batteriespeicher kann zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eingesetzt werden. Ausgeschlossen ist der Strom aus Anlagen benachbarter Gebäude.
„Der Strombezug der beteiligten Mietparteien muss ebenso wie die Stromerzeugung der Photovoltaikanlage viertelstündlich gemessen werden. Nur so kann der genaue Solarstromanteil jeder Mietpartei ermittelt werden", erklärt Inse Ewen. Dafür muss jeder Haushalt ein intelligentes Messsystem, Smart Meter genannt, haben.
Da in den meisten Mietshäusern Smart Meter bislang nicht installiert sind, muss deren Installation zuvor durch den Verteilnetzbetreiber, der gleichzeitig grundzuständiger Messstellenbetreiber ist, erfolgen. Der Gebäudebetreiber schließt mit den beteiligten Mietparteien Gebäudestromnutzungsverträge ab. In diesen Verträgen werden die jeweiligen Solarstromanteile und das Entgelt für den Solarstrom vereinbart.
Alle Parteien bleiben in der Wahl ihres externen Stromlieferanten frei. Dieser deckt den restlichen Strombedarf, der nicht von der Photovoltaikanlage geliefert werden kann.
Gebäudeeigentümer, die sich für die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung interessieren, wenden sich am besten zunächst an den örtlichen Verteilnetzbetreiber und klären, ob und welche Voraussetzungen zuvor zu erfüllen sind.
Zur Auslegung einer neuen Photovoltaikanlage sollten zuvor Beratungsangebote genutzt werden.
Fragen zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung beantwortet die kostenfreie Energieberatung der Verbraucherzentrale Bremen. Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen
Gespräch statt. Eine Terminvereinbarung ist unter tel. 0421-160 777 (Ortstarif) oder unter 0800-802 809 400 (kostenlos) erforderlich. Besuchen Sie die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bremen auf den Bremer Altbautagen vom 17. Januar bis 19. Januar 2025 in Halle 7 der ÖVB Arena, Stand 7F70.
Unsere zahlreichen Vorträge finden Sie unter www.vz-hb.de/veranstaltungen